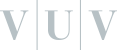Wer erfolgreich in Aktien investieren möchte, braucht nicht nur eine gute Strategie, sondern auch ein Bewusstsein für typische Fallstricke. Viele Anleger machen immer wieder dieselben Fehler bei der Aktienanlage – oft aus psychologischen oder praktischen Gründen. Der folgende Überblick zeigt die häufigsten Fehlentscheidungen und erklärt, wie man sie vermeiden kann.
Home Bias
Bei der Aktienanlage zeigen viele Anleger eine deutliche Neigung, bevorzugt in Unternehmen aus dem eigenen Land zu investieren. Dieses Phänomen wird als Home Bias bezeichnet. Die Ursachen dafür sind vielfältig und lassen sich in psychologische, praktische und wirtschaftliche Gründe unterteilen:
Psychologische Faktoren
Vertrautheit und Sicherheit: Anleger fühlen sich mit Unternehmen und Märkten aus dem eigenen Land wohler und sicherer, da sie diese besser kennen. Diese Vertrautheit vermittelt ein Gefühl von Kontrolle und reduziert subjektiv das wahrgenommene Risiko.
Bekanntheitseffekt: Menschen bevorzugen das Bekannte und wählen bei Unsicherheit eher Alternativen, die sie wiedererkennen.
Selbstüberschätzung: Viele Investoren glauben, die Risiken und Chancen heimischer Unternehmen besser einschätzen zu können, als dies tatsächlich der Fall ist.
Vermeidung von Komplexität: Investitionen im Ausland erscheinen oft komplizierter und erfordern mehr Recherche, etwa zu wirtschaftlichen oder regulatorischen Rahmenbedingungen.
Informations- und Marktzugang
Besserer Zugang zu Informationen: Über heimische Unternehmen und Märkte stehen meist mehr und leichter verständliche Informationen zur Verfügung. Sprachbarrieren und mangelnde Transparenz schrecken vor ausländischen Märkten ab.
Leichterer Zugang zu heimischen Anlagen: Inländische Wertpapiere sind für Privatanleger oft einfacher zu erwerben und zu handeln. Ausländische Märkte können höhere Eintrittsbarrieren und Transaktionskosten aufweisen.
Wirtschaftliche und regulatorische Aspekte
Klumpenrisiko: Viele Anleger haben ihren Arbeitsplatz und somit ihre wirtschaftliche Abhängigkeit dort, wo sie investieren. Das bezieht sich bei der Aktienanlage auf die Region und die Branche, in der sie beschäftigt sind. Dies führt bei wirtschaftlicher Verschlechterung ihres Umfelds zu einem hohen Klumpenrisiko (siehe auch 2.).
Währungsrisiko: Investitionen im Ausland sind mit Wechselkursschwankungen verbunden, die das Risiko erhöhen können. Viele Anleger bevorzugen daher Anlagen in der eigenen Währung.
Steuerliche und regulatorische Unterschiede: Steuerliche Vorteile oder einfachere Regulierung im Inland können Investitionen im Heimatmarkt attraktiver machen.
Klumpenrisiken
Klumpenrisiken bei der Aktienanlage entstehen, wenn ein Portfolio zu stark auf einzelne Unternehmen, Branchen oder Regionen konzentriert ist. Das zentrale Problem dabei ist, dass das Portfolio dadurch besonders anfällig für Verluste wird, wenn genau dieser Bereich negativ betroffen ist.
Fehlende Diversifikation: Wer beispielsweise nur Aktien eines Unternehmens oder einer Branche hält, macht die eigene Rendite komplett abhängig von deren Entwicklung. Kommt es dort zu Problemen, drohen hohe oder sogar totale Verluste.
Korrelation der Risiken: Auch wenn mehrere Titel gehalten werden, können diese stark miteinander korrelieren – etwa, wenn sie alle aus demselben Sektor stammen. Verluste in einem Bereich können dann nicht durch Gewinne in anderen ausgeglichen werden.
Beispiel: Ein Portfolio, das zu 70 % aus Technologieaktien besteht, ist besonders verwundbar, wenn der Technologiesektor insgesamt einbricht. Die Verluste können dann nicht durch andere Branchen kompensiert werden.
Das Problem von Klumpenrisiken ist also, dass sie das Gesamtrisiko des Portfolios erheblich erhöhen und im Extremfall zu einem Totalverlust führen können. Um Klumpenrisiken zu vermeiden, empfiehlt sich eine breite Diversifikation über verschiedene Unternehmen, Branchen und Regionen.
Keine Verluste realisieren
Aktienkurse schwanken ständig. Der eigene Einstandspreis hat objektiv nichts mit dem investierten Objekt zu tun, wird aber häufig psychologisch verbunden. Der Einstandspreis wird dabei zu einem Ankerpunkt und verhindert die objektive Beurteilung des Investments.
Hinzu kommt, wenn man bei der Aktienanlage nicht bereit ist, Verluste zu realisieren, dass Buchverluste (also Kursverluste auf dem Papier) steuerlich nicht geltend gemacht werden können. Nur realisierte Verluste – also Verluste, die durch einen tatsächlichen Verkauf der Aktien entstehen – können mit Gewinnen aus anderen Aktienverkäufen verrechnet und so zur Minderung der Steuerlast genutzt werden.
Wer Verluste nicht realisiert, läuft Gefahr:
Steuerliche Vorteile zu verpassen: Nur realisierte Verluste können mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechnet werden. Dies kann die zu zahlende Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge senken. Erst nach einem Verkauf fließen sie in den sogenannten Aktienverlustverrechnungstopf ein, der für die steuerliche Verrechnung notwendig ist.
Psychologische Fehler zu machen: Wer aus Angst vor dem Eingeständnis eines Fehlers an verlustreichen Aktien festhält, riskiert, dass sich die Verluste weiter ausweiten und das Kapital langfristig gebunden bleibt.
Wichtig ist deshalb: Nur realisierte Verluste zählen für die Steuer – Buchverluste nicht. Wer also nicht bereit ist, Verluste zu realisieren, verschenkt die Möglichkeit, diese steuerlich zu nutzen, und blockiert eine objektive Beurteilung jedes einzelnen Investments.
Zu früh verkaufen
Ein klassischer Fehler bei der Aktienanlage ist es, zu früh zu verkaufen, weil dadurch oft das langfristige Renditepotenzial verschenkt wird. Viele Anleger neigen dazu, Gewinne schnell mitzunehmen, um das Risiko von Verlusten zu vermeiden. Doch wer zu früh aus erfolgreichen Investments aussteigt, verpasst häufig die Möglichkeit auf deutlich höhere Gewinne, die sich durch langfristiges Halten ergeben könnten.
Hinter diesem Verhalten steckt oft der sogenannte Dispositionseffekt: Anleger realisieren Gewinne zu früh aus Angst, diese wieder zu verlieren, während sie Verluste zu lange aussitzen (siehe auch 3.). Emotionen wie Unsicherheit und Angst führen dazu, dass rationale Überlegungen bei der Aktienanlage in den Hintergrund treten.
Das Ergebnis: Die Rendite wird geschmälert, weil große Kurssteigerungen meist erst über längere Zeiträume entstehen. Geduld und das Festhalten an einer langfristigen Strategie werden an der Börse oft belohnt, während ein zu frühes Verkaufen das Ertragspotenzial erheblich begrenzen kann.
Stopp-Loss nicht einhalten
Ein Stopp-Loss bietet die Möglichkeit, Verluste bei der Aktienanlage automatisch zu begrenzen. Er ist eine Verkaufsorder, die ausgelöst wird, wenn der Kurs einer Aktie einen vorher festgelegten Schwellenwert erreicht oder unterschreitet. Dadurch wird das Wertpapier automatisch verkauft, bevor der Verlust noch größer wird. So schützt ein Stopp-Loss Anleger vor unerwarteten, starken Kursrückgängen und ermöglicht es, das Risiko zu kontrollieren, ohne den Markt ständig beobachten zu müssen.
Häufig wird ein Stopp-Loss jedoch nicht eingehalten – selbst wenn er gedanklich gesetzt oder als Strategie festgelegt wurde. Die Gründe dafür sind meist psychologischer Natur:
Verlustaversion: Viele Anleger hoffen, dass sich der Kurs wieder erholt, und zögern den Verkauf hinaus, um Verluste nicht realisieren zu müssen.
Überoptimismus: Anleger glauben oft, sie könnten den perfekten Ausstiegszeitpunkt besser einschätzen als eine automatische Order.
Emotionale Bindung: Wer an eine Aktie „glaubt“, hält oft zu lange an ihr fest, selbst wenn die eigenen Regeln einen Verkauf vorsehen.
Falsche Einschätzung der Marktsituation: Anleger interpretieren Kursrückgänge als temporäre Schwankungen und ignorieren den Stopp-Loss.
Diese Verhaltensweisen führen dazu, dass Verluste größer werden können als ursprünglich geplant, was das Risiko im Portfolio erhöht und die ursprüngliche Risikobegrenzung durch den Stopp-Loss unterläuft.
Angst, etwas zu verpassen – FOMO
Das Risiko bei der Fear of Missing Out (FOMO) besteht darin, dass Anleger aus Angst, eine Chance zu verpassen, impulsive und wenig durchdachte Investitionsentscheidungen treffen.
Die typischen Folgen sind:
Überstürzte Käufe: Anleger steigen in gehypte Märkte oder Aktien ein, oft zu Höchstkursen, ohne eine fundierte Analyse durchzuführen.
Vernachlässigung der eigenen Strategie: Die Angst, nicht dabei zu sein, führt dazu, dass langfristige Anlagestrategien ignoriert und rationale Überlegungen ausgeblendet werden.
Erhöhtes Verlustrisiko: Wer auf dem Höhepunkt einer Hype-Phase kauft, läuft Gefahr, bei einer Korrektur schnell Verluste zu erleiden, da die Kurse nach dem Hype häufig wieder fallen.
Emotionale Achterbahnfahrt: FOMO verstärkt Stress und Unsicherheit und kann zu weiteren emotional getriebenen Fehlentscheidungen führen.
FOMO ist somit ein schlechter Ratgeber an der Börse, da es Anleger dazu verleitet, dem Herdentrieb zu folgen, statt auf eine solide Analyse und eine klare und dauerhafte Strategie zu setzen.
Wichtige Hinweise:
Die in der Rubrik zur Verfügung gestellten Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Informationen im Rahmen von Finanzanlagen unterliegen aber stetiger Veränderungen und wechselnder Einschätzungen. Eine Haftung wird ausgeschlossen.
Sofern in den Darstellungen Charts verwendet werden, beziehen sich diese auf den dort angegebenen vergangenen Zeitraum, die angegebene Währung und es ist angegeben, ob es sich um eine Betrachtung vor oder nach Kosten handelt. Eine Kurs- oder Wertentwicklungen in der Vergangenheit ist kein verlässlichen Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jede Finanzanlage hat bestimmte Risiken, bitte beachten Sie die Risikohinweise.
Die Plutos Vermögensverwaltung AG ist ein kommerzieller Anbieter, die Ausführungen können daher auch werbliche und bezahlte Elemente beinhalten. Die Informationen stellen keine Anlageberatung oder Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern sind eine Momentaufnahme der Finanzmärkte. Wir empfehlen grundsätzlich vor jeder Entscheidung die Beratung durch Ihre Bank oder einen unabhängigen Vermögensverwalter. Die Plutos Vermögensverwaltung AG erhält, sofern nicht anders angegeben, keine besondere Vergütung für die veröffentlichten Beiträge. Sofern sie aber Funktionen im Rahmen einer dargestellten Finanzanlage wahrnimmt, kann sie hierfür eine Vergütung erhalten.
Zur weiteren Information beachten Sie bitte die rechtlichen Hinweise.