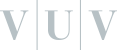Welche Alternative ist die bessere: High-Yield Anleihen oder Investment Grade Anleihen?

Einführung: Anleihen als Baustein im Portfolio
Der Anleiheteil eines Portfolios hat zwei Aufgaben. Er soll planbare Erträge liefern und zugleich Schwankungen dämpfen. Dabei stehen zwei Segmente im Mittelpunkt. Investment Grade steht für Stabilität und hohe Zahlungsfähigkeit der Emittenten. High-Yield steht für höher laufende Erträge und mehr Chancen, geht aber mit spürbar höheren Risiken einher. Beide Segmente lassen sich sinnvoll kombinieren.
Die Eigenschaften von Investment Grade Anleihen
Investment Grade umfasst Anleihen von Emittenten mit solider und sehr solider Bonität. Dazu zählen viele Staaten, Förderbanken und große Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen. Diese Anleihen zahlen in der Regel niedrigere Zinsen, bieten dafür aber eine hohe Rückzahlungswahrscheinlichkeit und eine gute Handelbarkeit auch in bewegten Marktphasen.
Rendite und Risiko werden vor allem vom allgemeinen Zinsniveau und zu einem geringeren Teil von moderaten Schwankungen der Risikoaufschläge geprägt. Investment Grade ist damit das Rückgrat des Anleiheblocks. Es stabilisiert die Depoterträge und hält die Handlungsfähigkeit hoch.
Schaubild 1: Länderratings für europäische Staaten

Die Eigenschaften von High-Yield Anleihen
Als „Non-Investment-Grade”, auch bekannt als „High-Yield” oder „Junk”, bezeichnet man Anleihen mit einem Rating unterhalb von BBB-. Diese Anleihen werden auch als spekulativ bezeichnet.
Als Ausgleich für das höhere Ausfallrisiko zahlen diese Emittenten spürbar höhere Zinsen. Die Anleihenkurse reagieren deutlicher auf Konjunktur, Unternehmensthemen und Marktstimmung. In freundlichen Phasen können Risikoaufschläge sinken und Kursgewinne zusätzlich zu den – im Vergleich zu Investment Grade Anleihen – erhöhten Kupons entstehen. In Stressphasen können die Kurse entsprechend im Gegenzug stärker fallen und die Handelbarkeit kann zeitweise eingeschränkt sein. Eine breite Streuung über viele Emittenten, Branchen und Regionen ist daher zentral.
Crossover Bereich: Die Schwelle zwischen High-Yield und Investment Grade
Interessant sind auch Anleihen, die in der Grenzzone zwischen High-Yield und Investment Grade liegen. Investoren sprechen auch von dem Crossover-Bereich. Diese Anleihen bieten höhere Renditen als sichere Investment Grade Anleihen, aber geringeres Risiko als klassische High-Yield Anleihen. Einige Fonds haben sich auf diesen Bereich spezialisiert und entsprechend flexible Portfolios aufgebaut.
Crossover-Anleihen liefern auch einen Konjunkturindikator: Wenn ein Crossover-Unternehmen zunehmend in die High-Yield Kategorie abrutscht, dann reflektiert dies vermutlich eine finanzielle Verschlechterung für viele Unternehmen und mithin eine konjunkturelle Abschwächung. Wenn sich die konjunkturelle Lage wieder bessert, dann steigt die Zahl der Unternehmen, die ins Investment Grade aufsteigen.
Nicht selten kommt es auch zu sogenannten Split-Ratings: Wenn z.B. S&P ein Investment Grade Rating vergibt, während Moody’s ein Unternehmen als High-Yield einstuft.
Manche Fonds lassen in den Anlagebedingungen Split-Ratings zu, auch wenn sie eigentlich nur in Investment Grade Anleihen investieren dürfen. Die Regeln diesbezüglich können sehr komplex sein.
Tabelle 1: Bonitätsstufen im Vergleich

Quelle: NZZ
Ausfallwahrscheinlickeiten nach Ratingklassen
Ratingagenturen wie Moody’s, Standard & Poor’s (S&P) oder Fitch bewerten die Bonität von Unternehmen anhand quantitativer und qualitativer Faktoren. Die daraus resultierenden Ratings – etwa AAA, BBB oder B – dienen Investoren, Banken und Aufsichtsbehörden als Maßstab für die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Emittent seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Die Ratingstufen spiegeln die geschätzte Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default) wider, also die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ein Schuldner innerhalb eines bestimmten Zeitraums – meist ein Jahr – ausfällt.
Tabelle 2: Ausfallwahrscheinlichkeiten nach Ratingklassen (USA, Europa)
in Prozent, Durchschnitt 1981 bis 2023

Quelle: Plutos, Standard & Poor‘s.
Die Tabelle zeigt, dass die Ausfallwahrscheinlichkeiten steigen, je weiter man nach vorne blickt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine europäische Anleihe mit einem BBB-Rating innerhalb eines Jahres ausfällt, liegt nur bei 0,05 %. Die Wahrscheinlichkeit steigt aber, wenn man einen Fünfjahreszeitraum betrachtet, auf 0,48 % bzw. auf 1,30 % bei einem zehnjährigen Zeitraum. Das Ausfallrisiko ist auch der Grund, warum Anleihen mit längeren Laufzeiten in der Regel höhere Renditen erzielen.
Augenfällig ist auch, dass die Ausfallwahrscheinlichkeiten unterhalb des Investment Grade Ratings sehr stark ansteigen. Während eine europäische BBB-Anleihe mit 5 Jahren Restlaufzeit, siehe oben, eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,48 % hat, so steigt die Wahrscheinlichkeit auf 3,40 % für eine BB-Anleihe und auf 11,78 % für eine B-Anleihe. Wobei die Zahlen jeweils den Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2023 abbilden und die Ausfallwahrscheinlichkeiten stark vom Konjunkturzyklus abhängen.
Drittens fällt auf, dass US-Emittenten bei gleicher Ausfallwahrscheinlichkeit durchgehend bessere Ratingnoten bekommen. Für die Gründe gibt es sehr unterschiedliche Erklärungsversuche. Häufig wird dabei die Frage beantwortet, warum ist die Ausfallwahrscheinlichkeit bei US-Unternehmen höher ist, bzw. in Europa geringer. Das rechtfertigt aber nicht unterschiedliche Maßstäbe bei der Vergabe von Bonitätsnoten. Am stichhaltigsten ist das Argument, dass europäische Unternehmen einen Default vermeiden, indem sie außergerichtliche Restrukturierungslösungen mit Anleiheinvestoren suchen. Die Lösungen kosten den Investoren Geld, gelten für die Ratingagenturen aber nicht als „Ausfall“.
Folgende Faktoren haben einen Einfluss auf die Bewertung der Agenturen:
- Ratingagenturen bewerten einerseits quantitative Faktoren wie den Verschuldungsgrad, die Kapitalstruktur, die Zinsdeckungsquote, Liquiditätskennzahlen und Rentabilität.
- Andererseits finden auch qualitative Aspekte – etwa Marktstellung, Managementqualität und strategische Ausrichtung Berücksichtigung.
- Drittens spielen externe Faktoren eine Rolle: Branchenzyklizität, Zinsniveau und makroökonomisches Umfeld beeinflussen die Bonität eines Unternehmens. In Rezessionen steigen die Ausfallraten regelmäßig an, selbst innerhalb derselben Ratingkategorie.
Historische Ausfallraten belegen die enge Korrelation zwischen Ratingniveau und tatsächlicher Insolvenzhäufigkeit. Dennoch sind Ratings keine Garantie: Sie reagieren oft verzögert auf neue Informationen. Abrupte wirtschaftliche Schocks können die statistischen Zusammenhänge kurzfristig aushebeln. Für ein fundiertes Risikomanagement ist daher die Kombination aus externen Ratings, internen Kreditbeurteilungen und laufender Marktbeobachtung entscheidend.
Schaubild 2: 5-jährige Ausfallraten nach Ratingklasse (USA, Europa)

Quelle: Plutos, Standard & Poor‘s.
Verlustanteil bei Ausfall
In der Praxis werden Ratings häufig in quantitativen Kreditrisikomodellen umgesetzt. Banken und Investoren übersetzen, wie beschrieben, jede Ratingstufe in eine statistische Ausfallwahrscheinlichkeit, um Ausfallrisiken über Portfolios hinweg vergleichbar zu machen.
Zur Berechnung des erwarteten Verlusts muss zusätzlich noch der Verlustanteil im Fall eines Forderungsausfalls abgeschätzt werden. Meist erhalten die Investoren bei einer Insolvenz einen Anteil ihres Investments zurück. Historisch liegt der Anteil etwa bei 40 % bis 70 %. Im Einzelfall auch höher oder niedriger.
- Um den erwarteten Verlust abzuschätzen, muss der Verlustanteil mit der Ausfallwahrscheinlichkeit multipliziert werden.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Ein Kredit an ein Unternehmen hat eine Ausfallwahrscheinlichkeit auf Sicht von einem Jahr von 1,8 % (entspricht einem B-Rating). Der erwartete Verlustanteil liegt bspw. bei 45 %. Daraus ergibt sich ein erwarteter Jahresverlust von 81 Basispunkten (0,45 x 0,018) oder 81 Cent pro 100 Euro Investment. Mindestens dieser zu erwartende Verlust sollte sich in einer entsprechend erhöhten Rendite widerspiegeln.
High-Yield Anleihen: Zwischen Aktien und sicheren Investment Grade Anleihen
Anleihen dienen in der Regel dazu, ein Aktienportfolio zu ergänzen. Daher ist es sinnvoll, Investment Grade und High-Yield Anleihen mit Aktien als dritte Anlageform zu vergleichen.
Die Wahl der richtigen Anlageform hängt maßgeblich von Risikobereitschaft, Anlagehorizont und Renditeerwartungen ab. Aktien, High-Yield Anleihen und Investment Grade Anleihen unterscheiden sich in diesen Aspekten deutlich und eignen sich jeweils für unterschiedliche Anlegertypen.
Aktien eignen sich vor allem für Anleger mit einem langen Anlagehorizont, die Schwankungen am Markt aushalten können und bereit sind, kurzfristige Verluste zu tolerieren, um langfristig von Wachstum und Wertsteigerungen zu profitieren. Der Vorteil liegt in der Diversifikation durch unterschiedliche Branchen, Regionen und Unternehmensgrößen, wodurch das Risiko über das Portfolio gestreut werden kann.
High-Yield Anleihen eignen sich für Anleger, die bereit sind, ein erhöhtes Risiko einzugehen, um überdurchschnittliche Erträge zu erzielen, und die über die nötige Risikokompetenz verfügen, die Bonität der Emittenten zu beurteilen. Sie reagieren in der Regel empfindlicher auf wirtschaftliche Abschwünge als Investment Grade Anleihen, bieten jedoch in stabilen Marktphasen attraktive Renditechancen und können eine wertvolle Ergänzung für renditeorientierte Portfolios darstellen.
Investment Grade Anleihen eignen sich besonders für konservative Anleger, die Stabilität und planbare Erträge schätzen, etwa durch regelmäßige Zinszahlungen. Investment Grade Anleihen sind weniger volatil als Aktien und High-Yield Papiere, bieten aber langfristig geringere Renditechancen. Sie dienen häufig der Diversifikation innerhalb eines Portfolios und können insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Phasen als Sicherheitsanker fungieren.
In der Praxis entscheiden sich viele Anleger für eine Mischstrategie, um die Vorteile der unterschiedlichen Anlageklassen zu kombinieren. Aktien liefern Wachstumschancen, High-Yield Anleihen erhöhen das Renditepotenzial bei akzeptablem Risiko, und Investment Grade Anleihen stabilisieren das Portfolio. Die Gewichtung hängt vom individuellen Anlageziel, der Risikobereitschaft und der Markteinschätzung ab. Für langfristig orientierte Investoren können Aktien und High-Yield Anleihen den Portfolioertrag deutlich steigern, während Investment Grade Anleihen Sicherheit und Liquidität bieten.
Geschickte Anleger schichten ihr Portfolio vor einem Aktiencrash in Investment Grade Anleihen um und reduzieren nach dem Crash die Anleihequote wieder. So können sie überdurchschnittlich an der zu erwartenden Erholung partizipieren. High-Yield Anleihen sind für eine solche Strategie wenig geeignet, da sie häufig auch Kurseinbußen erleben. Die Verluste sind in der Regel jedoch geringer als bei Aktien (vgl. Schaubild).
Schaubild 3: Performance von US-Aktien und US-Anleihen im Vergleich zwischen 07.2024 bis 10.2025

Quelle: Plutos, Bloomberg.
Das Schaubild zeigt, dass im April 2025 die Zollpläne des US-Präsidenten die Aktienkurse auf Talfahrt geschickt haben. High-Yield Anleihen wurden auch in Mitleidenschaft gezogen. Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (Investment Grade) profitierten dagegen zunächst von der Verunsicherung. Im weiteren Verlauf drückten Inflationssorgen vorübergehend die Anleihekurse. Wobei alle Indizes die jeweilige Performance abbilden. Mithin bei Aktien Kursgewinne und Dividenden und bei den Anleihen Kursgewinne und Kuponzahlungen (verteilt aufs Jahr).
Insgesamt zeigt das Schaubild aber die typische Marktentwicklung: Zwischen Juli 2024 und Oktober 2025 hatten die Aktien (S&P Index) die stärkste Performance, gefolgt von High-Yield. Die Performance von Unternehmensanleihen (Investment Grade) und US-Staatsanleihen zeigten dagegen deutlich geringere Schwankungen, aber auch entsprechend geringere Erträge.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass keine der drei Anlageformen per se besser ist, sondern dass sie komplementär wirken. Aktien bieten das höchste Wachstums- und Gewinnpotenzial, High-Yield Anleihen eine attraktive Rendite bei mittlerem Risiko, und Investment Grade Anleihen dienen der Stabilisierung. Wer alle drei Anlageklassen gezielt kombiniert, kann ein ausgewogenes Portfolio aufbauen, das sowohl Ertrag als auch Sicherheit berücksichtigt.
Strategien, die sich für Anleiheportfolios anbieten
Anleihen besitzen ein asymmetrisches Ertragsprofil:
- Die Aufwärtsrendite ist begrenzt. Der Nominalwert kann zwar während der Laufzeit auf über 100 % ansteigen. Der Rückzahlbetrag am Ende der Laufzeit wird aber wieder dem Nominalwert entsprechen.
- Die Abwärtsseite kann dagegen stark negativ sein. Im Fall eines Zahlungsausfalls drohen, wie beschrieben, Verlustraten von 40 % bis 70 %.
Einzelne Ausfälle wirken somit überproportional negativ auf die Gesamtrendite, während Kursgewinne gering und vorübergehend sind. Ein Beispiel: In einem High-Yield Portfolio mit 20 Titeln kann ein einziger Default die Jahresrendite um etwa 3 Prozentpunkte senken. Bei Aktien sind im Gegensatz dazu Chancen und Risiken deutlich symmetrischer verteilt: Verluste bei einer Aktie können durch Gewinne anderswo kompensiert werden.
Die Konsequenz ist, dass Anleiheportfolios eine deutlich breitere Diversifikation erzwingen, um idiosynkratische Ausfallrisiken zu streuen. Andererseits hat sich gezeigt, dass die Ausfallrisiken deutlich unternehmensspezifischer sind als etwa Aktienkurse, die in einer deutlich engeren Beziehung zum Gesamtmarkt stehen.
In einem Aktienportfolio diversifiziert man zur Glättung der Volatilität. In einem Anleihe-Portfolio diversifiziert man, um Ausfallverluste zu vermeiden.
Daher benötigt ein gut diversifiziertes High-Yield Portfolio etwa 100 Emittenten für ein stabiles Risikoprofil, während in einem Aktienportfolio etwa 30 Aktien für eine ähnliche Diversifikationseffizienz genügen.
Neben der besseren Risikostreuung zielt eine gute Diversifikationsstrategie auch auf die Steuerung der Duration (Zinsrisiko) und häufig auch auf einen stabilen Cashflow.
Schaubild 4: Beispiel für ein gut diversifiziertes Anleiheportfolio mit High-Yield Anteil

Quelle: Plutos.
Fazit
Anleihen sind ein zentraler Bestandteil jedes ausgewogenen Portfolios. Sie erfüllen zwei wesentliche Funktionen: Sie liefern planbare Erträge und stabilisieren zugleich die Gesamtentwicklung des Depots. Die Gegenüberstellung von Aktien, High-Yield Anleihen und Investment Grade Anleihen verdeutlicht, dass keine Anlageklasse für sich allein optimal ist. Aktien bieten langfristiges Wachstum, unterliegen aber hohen Schwankungen. High-Yield Anleihen erhöhen das Renditepotenzial, sind jedoch konjunkturabhängig. Investment Grade Anleihen liefern Stabilität, allerdings bei geringerer Rendite. In Kombination ermöglichen diese drei Anlageformen eine ausgewogene Balance aus Sicherheit, Ertrag und Flexibilität.
Ein fundiertes Verständnis der Ratingstruktur und Ausfallwahrscheinlichkeiten ist dabei unverzichtbar. Ratings geben Orientierung über das Kreditrisiko, sind jedoch keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Historische Daten zeigen, dass Ausfallrisiken mit sinkender Bonität stark ansteigen. Neben dem Ausfallrisiko ist es wichtig, auch den Verlustanteil im Ausfallfall abzuschätzen. Gemeinsam bestimmen Ausfallrisiko und Verlustanteil die tatsächliche Risikoprämie und bilden somit die Grundlage jeder Renditeerwartung.
In der praktischen Umsetzung eines Anleiheportfolios kommt der Diversifikation eine entscheidende Rolle zu. Breite Streuung über viele Emittenten, Branchen und Regionen verringert das Risiko einzelner Ausfälle und stabilisiert die Erträge. Ferner sollten Anleger die Laufzeiten aktiv steuern, um Zinsänderungsrisiken zu begrenzen und stabile Cashflows zu sichern.
Insgesamt zeigt sich: Erst das gezielte Zusammenspiel unterschiedlicher Bonitätssegmente und Laufzeiten schafft ein robustes, renditeorientiertes und zugleich risikobewusstes Portfolio. Wer diese Balance beherrscht, nutzt das Potenzial der Anleihemärkte optimal und stärkt die Stabilität seines Gesamtvermögens nachhaltig.
Wichtige Hinweise:
Die vorstehenden Angaben und die Darstellungen inklusive Einschätzungen (im Folgenden auch „Informationen“ genannt) wurden von der Plutos Vermögensverwaltung AG nur zu Informationszwecken erstellt. Sie stellen keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Die Informationen stellen weder ein Angebot für den Abschluss eines Vermögensverwaltungsvertrages noch eine direkte oder indirekte Empfehlung für den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar und ersetzen nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Sie dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen weder eine persönliche Empfehlung als Teil einer Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- und Anlageempfehlung („Finanzanalyse“) dar. Dies gilt auch dann, wenn einzelne Emittenten oder Wertpapiere erwähnt werden.
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Die hier abgegebenen Einschätzungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen getroffen und stammen aus oder beruhen (teilweise) auf von uns als vertrauenswürdig erachteten, aber von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen. Die Plutos Vermögensverwaltung AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung der Informationen für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und Einschätzungen keine Gewähr. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutos Vermögensverwaltung AG zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern können. Diese können daher durch aktuelle Entwicklungen überholt sein oder sich ansonsten geändert haben, ohne dass die bereitgestellten Informationen, Einschätzungen, Meinungsäußerungen oder Darstellungen geändert wurden beziehungsweise werden. Bei Bedarf setzen Sie sich deshalb bitte mit uns in Verbindung.
Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Diese Informationen inklusive Einschätzungen dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weiterverteilt oder veröffentlicht werden, sofern nicht hierfür ausdrücklich durch die Plutos Vermögensverwaltung AG vorgesehen. Jede Haftung für direkte beziehungsweise indirekte Schäden oder Folgeschäden aus Handlungen, die aufgrund von Informationen vorgenommen werden, die in dieser oder einer anderen Dokumentation und/oder Publikation der Plutos Vermögensverwaltung AG enthalten sind, wird abgelehnt.
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG).
Diversifikation reduziert das Gesamtrisiko.
Literatur und Quellen:
- Das Rating der wichtigsten Länder | FAZ:
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/das-rating-der-wichtigsten-laender-11559126.html
- Die Schweiz wird von Rating-Agenturen mit der Bestnote «AAA» bewertet. Wie kommt es zu einer solchen Beurteilung? | NZZ
https://www.nzz.ch/finanzen/fonds/ratings-mehr-als-nur-ein-buchstabe-ld.1404399
- Default, Transition, and Recovery: 2023 Annual Gl | S&P Global Ratings